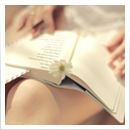1
Organisatorisches / Was ist Ton?
Abbildung 1: Unterschiedliche Sorten von Tonmasse
Protokoll der LV
Jede Einheit müssen zwei Studierende ein gemeinsames Protokoll der LV-Einheit verfassen.
Für die Protokolle wird eine InDesign-Vorlage auf Drop-
box (Link: https://www.dropbox.com/l/scl/AABjlw- trnbQJGcK30mgH9y-PKxnu5pRpj7U ) abrufbar sein. Die fertigen Protokolle, die auch Bilder beinhalten sollen, müssen als PDF auf Dropbox geladen werden. Abbildungen sollten beschriftet werden und groß genug (ca. 9x13 cm) sein.
Die Bilddateien sollen auch noch zusätzlich in den jeweiligen Ordner der Einheit als »Bildordner« gespeichert werden.
Abbildung 2: Katalog der Firma Skokan
Was ist Ton?
Ton ist hauptsächlich anorganisches Material also zerfallenes Gestein.
Ton ist gereinigter Lehm. Die Farbe des Tons ist abhängig von der Gesteinsart. Eisenhaltiger Lehm/ Ton ist zum Beispiel rot.
Was ist Erde?
Erde ist organisches Material, also alles, was einmal gelebt hat.
Wie unterscheide ich Erde von Lehm?
Selbst gefundenen Ton/Lehm kann man testen, indem man ihn im Brennofen brennt und schaut ob er zerfällt oder hält (Das Material, das hält, ist Ton). Im Lagerfeuer erreicht man ca. 700 Grad C.
Paper Clay (auch: Papierton)
Papierton ist Ton, welchem Papierfasern beigemischt sind. Paper Clay ist leichter als herkömmlicher Ton, man muss ihn aber auch baldigst verarbeiten, da er sonst zu schimmeln beginnt. Beim Brennen verbrennen die Papierpartikel. Vorteile von Paper Clay sind, dass die Masse leichter mo- dellierbar ist. Dicke Gegenstände können gleichmäßiger gebrannt werden, da der Ton durch die geringere Dichte auch im inneren Bereich schneller erhitzt werden kann.
Porzellan
Porzellan hat ein anderes Grundmaterial als Ton. Es besteht aus Kaolin und das ist ein ganz andere Grundsubstanz als die von Ton. Porzellan ist auch wasserdicht wenn es unglasiert ist. Porzellan wird nur einmal bei 1250-1300 Grad gebrannt. Wenn man Porzellan glasieren will, dann muss man es auch (wie den Ton) erst bei 980 Grad schrühen.
Porzellan lässt sich gießen und kneten, wie bei Ton.
Abbildung 3: Ton schneiden mit der Tonharfe
Welchen Ton soll man kaufen?
JedeR Studierende hat einen Katalog der Firma Ing. Skokan GmbH bekommen (siehe Abbildung oder https://www. skokan.at). Ing. Skokan GmbH ist ein Keramikbedarf, bei welchem man unterschiedlichste Arten von Ton, Glasuren und Brennöfen bestellen kann. Außerdem bietet die Firma eine Beratung von Fachkräften an.
Brennöfen
Jede Schule hat ein Recht auf einen Brennofen, soweit es einen Platz dafür gibt, und es kostet der Schule NICHTS!! Den Brennofen sollte man bei dieser Firma bestellen. Lichtstromöfen reichen eigentlich für Schulen aus. Steingut bis 1100 Grad Celsius reicht dafür aus. Runde Öfen (Toploa- der) sind für den Schulgebrauch ausreichend, da diese Größe nachhaltiger beheizbar ist für Werkstücke in Klassenstärke.
Tonmassen
Kaufen kann man Ton nicht nur bei Skokan, sondern auch bei Gerstaecker und Bösner, das Personal ist jedoch fachlich nicht so versiert. (VORSICHT: »Schulton« ist immer ölversetzt und deshalb UNGEEIGNET für die Schule!!!
Weißer Ton ist ein Guter Glasurträger. Wenn ich weißen Ton also grün färbe wird das auch schön grün. Wenn ich hingegen einen roten Ton mit grüner Glasur brenne, dann wird es wahr- scheinlich braun.
In der Schule sollte man sich mit dem Kollegium auf eine Farbe der Tonmasse einigen, damit das Werkzeug den Ton nicht verunreinigt (roter Ton würde weiße Arbeiten fleckig machen).
Dateiname:
»1.Einheit.Nachname1.Nachname2, 2.Einheit.Nachname1.Nachname2, ...«
Vorsicht! »SCHULTON« ist immer ölversetzt und deshalb UNGEEIGNET
für die Schule!!!
GK 2.3 Fertigungstechnik Keramik WS 2019
2
Was ist Ton?
Abbildung 4: die gängige Beschriftung von Tonhubeln
Scherben
Scherben nennt man geschrühtes Tonmaterial. (1. Brand ca. 980 Grad Celsius)
Steingut
Steingut ist Tonmaterial, das unter 1200 Grad gebrannt wer- den kann. Steingutmaterial ist nicht wasserdicht, ist also nicht für den Geschirrspüler geeignet, da der Ton Wasser aufnimmt (bspw. Blumentopf ).
Steinzeug
Steinzeug wird ab 1200 Grad gebrannt. Man sollte dafür man einen Starkstromofen kaufen. Für Geschirr sollte man Stein- zeug kaufen, wenn man es in den Geschirrspüler geben will, da das Tongut dann dicht ist.
Glasuren
Es gibt Glasuren für den Steingutbereich und für den Stein- zeugbereich.
In Japan wird dicker Schwarztee in eine Steinguttasse gegos- sen und eine Woche stehen gelassen um die Risse und somit die Tasse zu dichten.
Eselsbrücke zur Differenzierung zwischen Steingut und Steinzeug:
»G vor Z Steingut vor Steinzeug«.
Abbildung 5: Das passiert, wenn man unschamottierte Tonarten bei falscher Hitze in den Brennofen stellt.
Was ist Schamott?
Schamott ist eine zermahlene gebrannte Tonmasse, die man Ton in bestimmten Verhältnis zusetzt.
Schamott ist vergleichbar mit Semmelbrösel (gebackenes Mehl, das noch einmal verarbeitet wird. Man fügt Schamott bei, wenn ein Werkstück Stabilität braucht.
Es gibt unschamottierte Tonarten. Dessen Verwendung ist nur zum Drehen oder Gießen. VORSICHT: Wenn unschamot- tierter Ton zu heiß gebrannt wird, schmilzt das Tonmaterial und klebt an der Schamottplatte/Brennplatte. (Siehe Ab- bildung 5)
Es gibt Ton mit 20 - 25% Schamottanteil
sowie es einen zu 40 % schamottierten Ton gibt.
Schamott beeinflusst die Plastizität Feinschamottiert heißt, dass die Schamottkugeln 0 - 0,2 mm groß sind.
• 0 - 0,5 mm schamottierte Tone
• 1 mm schamottierte Tone
• 2 mm schamottierte Tone
Je größer die Schamotteilchen, desto stabiler das Werk- stück. Aber große Schamotteilchen lassen weniger plasti- sches, weniger detailreiches Arbeiten zu.
Abbildung 6: Skokan Katalog S. 6, Besprechung Ton Nr 264
Analyseübung von Tonarten aus dem Katalog »Ing. Skokan GmbH«
Besprechung des Ton Nr. 264 (auf S. 6 des Katalogs »Ing. Skokan GmbH« ; siehe Abbildung 6).
SG... Steingutmassen
SZG... Steinzeug geeignet
SIN... Beim Sintern wird noch einmal etwas heißer gebrannt (bei Porzellan könnte man das sagen) Sintern, wenn etwas gesintert ist kann ich es nicht mehr glasieren.
Auch der Brennbereich sollte beachtet werden.
Dem Katalog kann man drei Abbildungen des jeweiligen Tons entnehmen, weil sich die Farbe des Tons ändern kann, je höher er gebrannt wird.
TS... Tonschwindung in % heißt wieviel der Ton beim Luft- trocknen schrumft oder schwindet.
Die Brennschwindung in % wird zur Trockenschwindung addiert. Durchschnittlich schrumpft Ton insgesamt um etwa 10%.
»Wasseraufnahme in % bei Grad C« bezeichnet die Dichte des Materials nach dem Brennen. Dichte wird ebenfalls mit Temperatur angegeben. Jener Ton (Abbildung 6) im Katalog ist ab 1200 Grad dicht.
Ton kauft man in Hubeln (10kg Blöcken).
GK 2.3 Fertigungstechnik Keramik WS 2019
3
Werkstück - Daumenschale
Abbildung 7:
PRAXIS Test
Erkennen von zwei Tonarten (siehe Abbildung 7) 1. 40% Schamott 0 - 0,5 mm
2. 20% Schamott 0 - 0,2 mm
Ton sollte man nicht kneten, weil Luft hineinkommen kann und das beim Brennen zu Sprengeffekten am Werkstück führt.
Werkstück – Daumenschale
Die Daumenschale wäre auch in der Schule als erstes Ton- werkstück gut geeignet. Dafür ist kaum Werkzeug oder Wasser notwendig. (Höchstens Finger leicht befeuchten. Ein Reparieren der Risse mit Wasser reißt den Ton nur weiter auf.) Diese Aufgabe ist auch gut für einen Materialvergleich geeignet.
Werkzeug/Material
• Ton (fein (20% Schamott 0 - 0,2 mm) und grob (20% Schamott 0 - 0,2 mm)) (ca. 4 cm x 4 cm große Würfel)
• Schneidedraht zum Ton Schneiden (Vorsicht: Verletzungsgefahr beim Reinigen, wenn der Draht einen Knick hat. Alternative: Nylonschnur mit Rundholz (mit Loch) und Beilagscheibe.) (siehe Ab- bildung)
• Tonharfe mit Rillen um gleich dicke Platten abzu- schneiden (siehe Abbildung)
Zum Beschriften:
• Töpfernadel
Abbildung 8: benötigtes Werkzeug für Daumenschale
Anleitung
1. Den Ton Schlagen um Luft rauszubringen, 4 cm x 4 cm große Würfel zuschneiden und in eine Kugelform rollen. (Abbildung 10) Den Ton ununterbrochen in der Hand lassen.
2. Zuerst nur den Boden erarbeiten. Mit dem Daumen in die Kugel bohren und den Boden ausformen. Spüren wie dick der Boden ist, er soll ungefähr 0,8 cm dick werden. (siehe Abbildung 9)
3. Risse außen wieder verarbeiten (schmieren). Durch Drücken und Schmieren die Dicke des Rands der des Bodens angleichen. Die Wandstärke sollte überall ca. gleich dick sein. Den Rand nur soweit aufmachen wie es notwendig ist.
4. Zum Schluss stellt man die Schale auf die Platte um einen Boden festzulegen (1x mittelsanft auf die Platte stellen.).
Abbildung 10: Den Ton mit der Tonharfe schneiden.
Den Ton nicht kneten, weil Luft hineinkommen kann, das führt beim
Brennen zu Sprengeffekten.
Abbildung 11: Luftblasen loswerden
Wenn Ton als Fläche gebraucht wird: Luftblase aufstechen und drü-
berwalken. (Abbildung 11)
Abbildung 9: Boden ausformen
GK 2.3 Fertigungstechnik Keramik WS 2019
4
Werkstück – Plattentechnik
Abbildung 12: Tonplatte und Rohr in Zeitungspapier einwickeln.
Werkstück Plattentechnik
Material/Werkzeug
• Ton
• Rohr (Fester Karton oder aus Kunststoff )
• Zeitungspapier
• Holzleisten, um Plattenhöhe zu fixieren (ca. 0,5 cm)
• Nudelwalker oder Rohr
• Töpfernadel
• kariertes Papier
• Schere
• Tonmesser
1. Tonplatte und Rohr in Zeitungspapier einwickeln. Die Papierenden oben und unten reinstopfen. (Abbildung 12)
2. Eine Schablone aus Papier um die Röhre legen, diese sollte ca 1cm größer sein, als der Durchmesser der Rolle. (Abbildung 14).
3. Den Ton in Platten walken, von der Mitte ausgehend beginnen. Luftblasen mit Töpfernadel aufstehen und rausdrücken (siehe Abbildung 15)
4. Schablone auf ausgewalgten Ton legen. Etwa 1cm Übertritt von Schablone. Mit Tonmesser (Abbildung 17) entlang der Schablone die Tonplatte herausschneiden. Holzleiste anlegen um einen geraden Schnitt hinzube- kommen (siehe Abbildung 16).
5. Die Platte am Ende der Röhre aufwickeln, die Überlap-
pung verbinden und andrücken (Abbildung 18 und 19)
6. Schablone vom Rohrdurchmesser abnehmen (siehe
Abbildung 19). Bodenplatte etwa 2 mm größer halten.
Senkrechte Haltung des Messsers.
7. Die Ränder, wo die Verbindung der Platten sein wird,
Abbildung 14: Die Schablone für das Werkstück anlegen
vergrößern. Mit Schlicker nur einseitig bestreichen. Den Schlicker nur drauflegen und nicht einreiben. Über- stehenden Ton über das Gefäß entlang in die Höhe ver- schmieren und verkleben. (Abbildung 20 und 21)
8. Das Werkstück von der Rolle herunternehmen (dazu die Rolle aus dem Zeitungspapier herausziehen). (Abbil- dung 22)
9. Falls man was rausschneiden will (Bsp. Teelichtlampe), lässt man das Werkstück auf der Rolle drauf. (Abbildung 23)
10. Den Namen in die Werkunterseite kratzen.
Abbildung 16: Mit Tonmesser entlang der Schablone die Tonplatte herausschnei- den.
Abbildung 17: Modelliermesser und Tonmesser
zerkratzen, um die Fläche der Klebeverbindung zu
Abbildung 18: Die Platte am Ende der Röhre aufwickeln
Abbildung 15: Platten auswalzen
GK 2.3 Fertigungstechnik Keramik WS 2019
5
Werkstück - Plattentechnik
Abbildung 19: Schablone vom Rohrdurchmesser abnehmen
Abbildung 22: Das Werkstück von der Rolle herunternehmen
Abbildung 23: So kann das Werkstück aussehen
Abbildung 24: Falls man was rausschneiden will (Bsp. Teelichtlampe), lässt man das Werkstück auf der Rolle drauf.
Abbildung 25: Zwei Platten können durch
Drücken und Walzen einfach miteinander verbunden werden
Zwei Platten können durch Drücken und Walzen einfach mitein- ander verbunden werden (Abbildung 25).
Abbildung 20:
Abbildung 21: Die Platte am Ende der Röhre aufwickeln
GK 2.3 Fertigungstechnik Keramik WS 2019
3
Plattentechnik - Eckiges Gefäß
Vorgabe:
> Zweckgebundenes Gefäß aus ebenen Platten
> Kantenlänge nicht mehr als 12 cm
> Tonmasse: 25%Ton mit 0-0,5mm Schamott
> Als geschlossenes Gefäß bauen und Deckel im Nachhinein abschneiden > Plan/Schnitt für so ein Gefäß aus Papier entwickeln
> Umsetzung
Es gibt zwei Möglichkeiten, das Gefäß zusammenzufügen:
> stumpf zusammenfügen – im 90° Winkel
>auf Gehrung – im 45° Winkel (Kanten werden hier genauer)
Wir haben die Platten unserer Werkstücke mit Gehrung zusammengefügt.
1. Design und Vorlage:
Zuerst das Gefäß entwerfen und danach den Schnitt aus Pa- pier anfertigen. Alle Flächen mit Tixo fixieren, um die Form des Gefäßes zu sehen. Für das weitere Arbeiten mit Ton benötigen wir die drei Flächen des Schnittes auf Papier ausgeschnitten.
2. Ausrollen und Ausschneiden:
Den Ton, wie üblich bei Plattentechnik, mit Rollholz auf einer Unterlage mit Holzstäben, die die Dicke der Platte vorgeben, ausrollen. Anschließend die Papiervorlagen auflegen und mit einem Stab/Lineal und einem Messer die einzelnen Teile ausschneiden.
GK 2.3 Fertigungstechnik Keramik WS 2019
3
Plattentechnik - Eckiges Gefäß
3. Gehrungen für Verbindungen:
Wenn es sich um einen feuchten Ton handelt, nun etwas föhnen bis die Ränder„lederhart“ werden. Aber wenn es sich um einen bereits etwas trockenen Ton handelt, kann gleich weitergearbeitet werden.
Von den Kanten nach innen ca. 5mm leicht anzeichnen. Danach mit einem Messer in einem 45° Winkel von dieser Hilfslinie zur unteren Außenkante schneiden. Dabei soll die Messerspitze immer etwas vom Ton heraus sehen, ansonsten schneidet man zu tief und verfälscht somit die Außenkante. Wenn alle Einzelteile auf allen Verbindungskanten eine Geh- rung haben, Einzelteil für Einzelteil zusammenbauen.
GK 2.3 Fertigungstechnik Keramik WS 2019
3
Plattentechnik - Eckiges Gefäß
4. Zusammenbau:
Die Verbindungskanten für den Schlicker aufkratzen, auf eine Seite den Schlicker anbringen und die beiden Teile gut andrücken. Danach eine dritte Fläche anbringen, sodass ein
Eck entsteht. Mit einem dünnen Tonstrang die Innenkante mit dem Finger verschließen. Dabei den Tonstrang nur erst vorne anbringen und nach hinten verstreichend arbeiten. Es fällt nämlich etwas weg, da durch das verstreichen der Tonstrang sich verlängert. Von diesem einen Eck aus nun die restlichen Flächen anbringen und mit einem Tonstrang die Innenkanten verarbeiten. Den Deckel mit Schlicker daraufsetzen. Nun alle Außenkanten mit Daumen und Zeigefinger von oben nach unten verstreichen. Mit dem Schlagholz (großes flaches Modellierholz) alle Kanten gerade nacharbeiten. Mit der Tonkante mittig am Holz anlegen und von der einen Fläche über die Kante zur anderen Fläche drückend bewegen. Eventuell entstandene Höcker mit Finger verarbeiten.
GK 2.3 Fertigungstechnik Keramik WS 2019
3
Plattentechnik - Eckiges Gefäß
5. Aufschneiden:
Wenn das gesamte Gefäß noch etwas instabil und feucht wirkt, etwas föhnen.
Mit einem Messer eine Hilfslinie vorzeichnen, den „Schnabel“ nicht vergessen. Der Deckel soll durch den Schnabel auf der Dose sitzen bleiben. Statt dem „Schnabel“ kann der Deckel auch zB. durch eine spezielle Schnittkante (Schräge) auf der Dose halten. Danach mit einer sehr dünnen Metallspachtel nachschneiden. Es reicht, wenn die Spachtel gerade durchschneidet, man muss sie nicht tief hinein- stecken. Die Spachtel dabei unbedingt waagrecht halten. Nun die Innenseite bearbeiten. Da, wo der Deckel von außen geschlossen wurde, wurde die Innenkante noch nicht mit dem dünnen Tonstrang verarbeitet. Die Schnittkante, welche nun Dose von Deckel trennt, nicht weiterbearbeiten. Dies geschieht erst mit einem nassen Schwamm nach einer Trocknungszeit.
6. Trocknen:
Am Boden die Initialen eingravieren. Deckel auf der Dose platzieren und so als Ganzes trocknen lassen.
GK 2.3 Fertigungstechnik Keramik WS 2019
3
Brennofen
Schaltung des Brennofens:
> einräumen und schließen
> einschalten
> Programm einstellen und kontrollieren
> brennen lassen
> nach einer gewissen Abkühlphase öffnen und ausräumen
Der Schrühbrand wird bei ungefährt 960°C durchgeführt.
Der Brennofen wird auf Platten bestückt, welche mit „Beinen“ stapelbar sind – so hat man meh- rere Stockwerke zum Bestücken. Beim Schrühbrand können alle Tonwerke sich berühren oder sogar aufeinandergestellt werden, vorausgesetzt schwächeres steht auf schwereren Teilen. Achtung bei nächster Platte/nächstem Stockwerk reingeben. Die Tonwerke dürfen nicht höher als die Beine sein. Auch mit den Händen aufpassen, dass man keine Tonwerke umstößt. Die hohen Tonwerke werden ganz oben auf die letzte Platte gestellt.
Die Platten sind mit einem Plattentrennmittel beschichtet worden, welche aus Quarz und Kaolin besteht. Dadurch kann, falls Glasur auf Platte tropft, die Glasur leicht abgespachtelt werden. Ansonsten verhaftet die Glasur auf der Platte und wird bei jedem Brand flüssig.
GK 2.3 Fertigungstechnik Keramik WS 2019
3
Brennofen
Im Detail:
Es ist nach dem Einschalten immer das zuletzt vorhandene Programm eingestellt, welches auch veränderbar ist. Das heißt, auch wenn ich angenommen Programm 2 benötige, kann es sein, dass die Detaileinstellungen bei der Temperaturkurve verändert wurden. Daher immer alle Schritte durchklicken und mit der Liste vergleichen (am IKL an der Wand neben Steuerung).
1. Bei der ersten Einstellung geht es um die Vorlaufzeit. Die Zahl hier „0,08“ würde bedeu- ten, in 8 Minuten startet der Brennofen.
2. Die zweite Einstellung zeigt an, dass mit zB. „100“ also 100°C pro Stunde erhitzt wird. Sollte hier bei 100°C auch sein, außer es gab schon einen Rohbrand, dann ist auch höher möglich.
3. Die dritte Einstellung zeigt die Zwischen- temperatur an, zB. 600°C. Dann wird auf 600°C aufgeheizt.
GK 2.3 Fertigungstechnik Keramik WS 2019
3
Brennofen
4. Bei der vierten Einstellung sieht man, dass nun mit 130°C pro Stunde aufgeheizt wird.
5. Danach, bei der fünften Einstellung, wird die Endtemperatur zB. 960°C angegeben. Nun befinden wir uns auf der obersten Stufe der Temperaturkurve.
6. Bei der sechsten Einstellung geht es um die Haltezeit. Bei dem Schrühbrand wird keine benötigt, jedoch beim Glasurbrand, damit die Glasur ordentlich verrinnen kann.
7. Die nächste und letzte Einstellung wird „PASS“ benannt. Ab hier kühlt der Brennofen ab. Wenn man auf den Stopp-Knopf drückt, sieht man die momentane Temperatur drin- nen. Erst ab 150°C öffnen, bzw. wird man ihn nicht gleich ausräumen können, da er noch heißt ist – ähnlich einem Backofen.
Es gibt unter den Einstellungen auch einen sogenann- ten Mischbrand. Wenn Rohbrand und Glasurbrand in einem Brand gemacht werden möchte, kann das hier eingestellt werden. Dies bedeutet in dem Fall, dass der Temperaturanstieg nach dem Rohbrand eingestellt ist und die Haltezeit nach dem Glasurbrand.
Alles in allem kann gesagt werden, dass das brennen ca. einen Tag dauert. Ungefähr 10 Stunden bis er aufge- heizt ist und ungefähr 10 Stunden bis er wieder kühl ist.
GK 2.3 Fertigungstechnik Keramik WS 2019
3
Lehm
Zusatz:
Lehmkugeln im Feuer gebrannt (innen hohl + Luftloch)
GK 2.3 Fertigungstechnik Keramik WS 2019
4
Glasieren
Flüssigglasur (kann auch Streichglasur genannt werden)
Für die Schule macht nur die Flüssigglasur Sinn, da die andere Glasur viel Abfall als auch viel Schmutz (eine Sauerei) macht.
- 3 Farben für die Schule reichen.
- Die Marke Mayco Flüssigglasuren (S. 26 in dem Heft) ist zwar für Steingut, kann aber auch für den Steinzeugbereich bis ca. 1230°C verwendet werden. Bei manchen Glasuren kann sich die Farbe etwas verändern.
wenn es trocken ist, nochmal drüberstreichen
-nass in nass bestreichen bringt nix, weil Glasur nur ver- schoben wird
-es ist egal ob zuerst innen oder zuerst außen gestrichen wird
Flüssigglasur ist in Fläschchen.
ACHTUNG unbedingt den Kiddis sagen: Fläschchen immer gut zuschrauben und richtiger Deckel zum richtigen Gla- surfläschchen + Pinsel immer oben drauf legen
Scherbe bestreichen - Ansatz muss nicht genau getroffen sein,
- es müssen 3 Glasurschichten gestrichen werden
- es können aber Layer gebaut werden, dann kommt die untere Farbe raus
- aber Achtung zB. bei der weißen Glasur würde dann der Pinsel gefärbt sein und eins darf dann nicht mehr mit dem Pinsel in das Fläschchen fahren, das ruiniert die weiße Farbe - Pinsel können mit Wasser abgewaschen werden
GK 2.3 Fertigungstechnik Keramik WS 2019
Pulverglasur
- für die Schule einfach nix
- Pulver wird mit Wasser angesetzt
- ca. Mischverhältnis: 1kg Pulverglasur + kaltes klares Wasser 700ml+300ml+100ml ->
- Pulverglasur wird immer geschüttet: eignet sich v.a. für das Innere von Gefäßen.
Beim Beschriften von Glasur: Brennbereich + Farbe + Nummer auf den Kübel picken und nicht auf den Deckel, die können vertauscht werden
Wenn die Glasur mit Wasser angesetzt wird, dann bildet sich ein Bodensatz. Der kann fast nicht mehr aufgerührt werden. Kann auch sein, dass
es nicht mehr aufgerührt werden kann und in den Müll landen muss. Es gibt auch Streichmittel: dann bleibt die Glasur auch in Schwebe (dh. sie setzt sich nicht so stark am Boden an)
wenn doch etwas Glasur sich an einer Stelle be- findet wo man es nicht haben möchte:
mit einem trockenen Schwamm mit der wei- chen Seite wegwischen
schütten: zuerst voll gießen
kurz warten, dann ausleeren. Es soll möglichst wenig am Gefäß außen abrinnen, da das dann wieder weggeputzt werden muss
-Bei Pulverglasur nur ein Mal schütten
Gründe wieso sie unpraktisch in der Schule ist:
Die Pulverglasur kann zum Teil vor dem Brand runter bröseln
- Die Pulverglasur tropft auch beim Brand im Ofen – Bildet dann so Tropfnasen, die wieder weggeschliffen werden müssen und auch auf der Ofenplatte landen können!
- Ein weiterer Grund der Gegen den Gebrauch von Pulverglasur in der Schule spricht: Tauchen braucht eine Unmenge Glasur - von 1kg Glasur kann nur 1 Fingerschälchen pro Schüler*in ge- taucht werden.
ALLGEMEINE INFOS zum Glasieren:
Glasuren können geschüttet, oder aufgepinselt werden. In der Industrie werden Glasuren ge- spritzt, getaucht oder geschüttet.
STANDFLÄCHEN WERDEN NICHT GLASIERT!! Da die Glasur flüssig wird und dann auf der Ofenplatte anklebt.
Wenn man beim Steinzeugbrand Füsschen darunter setzt, dann kann es sein dass sich das Füsschen in die Scherbe reindrückt (mit ziemlicher Sicherheit).
Ofenplatten sind mit Trennmittel beschichtet - so kann tropfende Pulverglasur abgekratzt werden. Danach muss die Platte nochmal beschichtet werden.
Trennmittel ist auch ein Pulver, das mit Wasser an- gerührt wird und mit Pinsel beschichtet wird.
Wenn Glasur und Ton keinen gleichen Ausdehnungkoäffizienten haben, dann springt die Glasur. Dh. wenn sich beim Brennen und Ab- kühlen das Material und die Glasur unterschiedlich ausdehnen, springt die Glasur (kleine, feine Härchenrisse). Das passiert eigentlich bei jedem Brand, ist aber so minimal, dass es nicht wirklich bemerkbar ist.
Gespritzt wird mit einer Airbrushtechnik in einer Spritzkabine. (auch nix für die Schule). Es braucht viel Übung um die bestimmte Dicke, die die Glasurschicht brauch so auftragen zu können.
IMMER VOR JEDER GLASUR:
mit sauberem Tuch oder trockenem Pinsel das Schührgebrannte Teil innen abpinseln. Es muss staubfrei sein, da sonst die Glasur beim Staub abrinnt und nicht am Scherben haftet. Aber NICHT reinpusten!
Wie bekomm ich Glasur weg, die übergelaufen ist:
+ mit einem trockenen Geschirr- schwamm aber mit der „nichtrauen“ Seite. Auf keinen Fall mit der blauen, rauen Seite (bleiben die blauen Fasern drinnen). Mit dem Schwamm einfach drüber rubbeln.
NIE GLASUR ABWASCHEN! DANN KANN GEFÄß NICHT MEHR GLASIERT WERDEN FÜR 1 WOCHE
Wenn ein Teil vor dem Schrühbrand bricht: Zuckerschlicker - bei flachen Teilen funktioniert das nicht sonderlich gut, je kleiner das Teil zum Kleben ist, desto besser
Mischverhältnis: 1:1 Zucker mit Schlicker mischen - das ist Superkleber für Ton, funktioniert nicht nach dem Schrühbrand.
KEINE GLASUR: ENGOBE:
Engobe (S.14/15) = gefärbter Ton, dh. zB. roter Ton auf den weiße Engobe im Lederharten Zustand gestrichen wird VOR dem Schrühbrand
muss transparent überglasiert werden nach dem Schrühbrand
NICHT ZU VERWECHSELN MIT SCHON GEFÄRBTEM TON der mit Farbkörper gefärbt wird
6
Größere Gefäße wie Vasen oder Schüsseln erzeugen
Zu Beginn wird für das Formen eines größeren Gefäßes wie beispielsweise einer Vase eine Dau- menschale geformt. Soll das Gefäß oval sein, so muss auch die Daumenschale oval geformt sein.
Für einen Raku Brand muss der Ton gut verdichtet sein. Das Ton-Würstel wird mit der Daumenkante flacher gedrückt, das Wurstende dabei aufheben, da das Ton-Würstel durch das Verdichten länger wird.
Die Daumenschale wird auf einer Schüssel plat- ziert, die mit Stoff bespannt wurde. Daumenscha- le nicht auf zu harter Fläche bearbeiten.
Für große Gefäße wird stark schamottierter Ton verwendet. Schalen müssen sowohl innen als auch außen sehr schön verarbeitet werden, Vasen deren Hals sehr eng geschlossen ist, hauptsäch- lich außen.
Anschließend wird das Ton-Würstel auf die Dau- menschale gelegt und beide Teile gut miteinan- der verbunden. Dazu einfach mit dem Daumen von oben nach unten oder von unten nach oben streichen, je nachdem wo mehr Ton ist, bis keine Verbindungsstelle mehr zu sehen ist.
Als nächsten Schritt werden aus dem Ton kleine „Würstel“ geformt. Das Tonstück wird so lange mit beiden Händen gerollt, bis es eine ebene Ober- fläche aufweist.
Falls die Wand zu dick wird, einfach mehr nach oben arbeiten und so korrigieren.
GK 2.3 Fertigungstechnik Keramik WS 2019
6
Größere Gefäße wie Vasen oder Schüsseln erzeugen
Als Alternative zu den Ton-Würsteln kann der Ton auch ausgewalkt und anschließend in Streifen geschnitten werden. Genau wie bei der anderen Variante, werden die Tonstreifen auf die Daumen- schale gesetzt und beides gut miteinander ver- bunden. Die Tonstreifen sind allerdings nicht so gut verdichtet wie die mit dem Daumen zurecht- gedrückten Ton-Würstel.
Die Vasenöffnung zum Abschluss wird vorher ge- formt und in der Größe, die sie schlussendlich ha- ben soll, auf das Gefäß gesetzt. Beim Verbinden sollte hierbei eher das Gefäß verformt werden, als der Ring/ die Öffnung.
Soll die Schale/Vase größer werden, so werden die Ton-Würstel/Tonstreifen nach außen überlap- pend angesetzt, soll die Schale kleiner werden, werden diese innen überlappend angesetzt.
Wird das Ton-Würstel oder der Tonstreifen nach innen überlappend draufgesetzt, so muss er vorher schon leicht gerundet werden und anschließend schräg draufgesetzt.
Das Gefäß wird danach mit einem Holzwerkzeug bearbeitet, um die Oberfläche glatter und gleich- mäßiger zu bekommen. Ist es noch nicht trocken genug, wird es vorher geföhnt. Zu guter Letzt wird das fertige Gefäß einmal auf einem harten Untergrund aufgesetzt, damit es steht.
GK 2.3 Fertigungstechnik Keramik WS 2019
2
Überarbeitung der Daumenschalen & Erstellung eigener Objekte
Schwämmchen in Wasser tauchen und nass machen
Wichtig: Wasser wieder gut ausdrücken, sollte nur feucht und nicht zu nass sein
Ein ovales Objekt herstellen:
n der Bodenmitte einen Schlitz hineinschneiden und den Ton aus dem Schlitz entfernen
Alle Kanten , Risse und Fingerabdrücke können so gut bearbeitet werden
Gegenstände immer mit beiden Händen vorsich- tig von UNTEN nehmen
Niemals an den Seiten halten, da diese sehr schnell abbrechen könnte
Dann das Objekt am Boden vorsichtig so eindrücken, dass der Schlitz geschlossen wird
GK 2.3 Fertigungstechnik Keramik WS 2019
Um in Ton unterschiedliche Ebenen zu erhalten: Beispiele von Materialien: Textilien über den Ton legen und mit dem Nudelwalker
darüber rollen Spitze, Strick, Leinen
Objekte von Studierenden
Glasur für Schulgebrauch: KEINE PULVERGLASUREN
Botz: fertig angerührt und deckt gut ab sind auch gut für den Schulgebrauch
Glasieren
Was ist Glasur?
Glasuren bestehen im Wesentlichen aus wasserunlöslichen Stoffen, die mit Wasser oder Hilfsmitteln zu cremiger bis obersartiger Konsistenz angerührt werden. Sie werden auf den geschrühten Scherben aufgetragen und im Glasurbrand aufgeschmolzen.
Glasuren sind
• Farblos oder farbig
• Transparent oder deckend (opak)
• Glänzend oder matt
• Rissfrei oder krakeliert
Eine gute Übersicht gibt es auf der Website der Firma Widhalm in Hornstein, Bgld., www.glasurfarbwerk.at Dort gibt es auch kompetente Beratung bei Fragen zum Glasieren oder Spezialwünsche betreffend.
Unter diesem Link
http://www.glasurfarbwerk.at/images/zug-downloads/steingutglasuren-glaenzend/TI-Steingutglasuren-glaenzend.pdf
können umfangreiche Infos zB zum Thema Steingutglasuren eingeholt werden.
Die Farbe der Glasur nach dem Brand richtet sich nach der Farbe des Scherbens (weiß, rot, braun,.....), wird aber auch von der Schichtdicke und evtl der Brennkurve des Ofens beeinflusst.
Glasurbrand
Im Steingutbereich und Steinzeugbereich erfolgt dabei der Schrühbrand bei etwa 960-980°, um gutes Glasieren zu ermöglichen, im Porzellanbereich kann es sinnvoll sein, bei etwa 1020-1030° zu schrühen, damit der Scherben etwas widerstandsfähiger (nicht so riss-und bruchanfällig) ist. Ist der Scherben erstmal dichtgebrannt (Steinzeugbereich), kann nicht mehr glasiert werden, die Glasur haftet dann nicht mehr auf dem Scherben. Nach dem Glasurbrand oder Glattbrand ist die Keramik mit einer glasartigen Schicht überzogen, die den Scherben weitgehend wasserdicht macht und gegen chemische oder mechanische Beanspruchung schützt.
Die optimale Temperatur des Glasurbrandes kommt auf die verwendete Glasur an. Im Steingutbereich wird meist ein Temperaturbereich von 1000-1080° angegeben.
Im Steinzeugbereich erfolgt der Glattbrand bei höherer Temperatur, 1100-1200°. Ebenso gilt dieser Bereich bei (Weich-)Porzellan. fertige Glasuren im Handel
Glasuren sind im Keramikhandel als Pulver oder fertig angerührt als Streichglasuren erhältlich. Der Preis richtet sich nach den enthaltenen Glasurbestandteilen, Pulverglasuren haben hier einen Preisvorteil, sind aber etwas schwieriger in der Anwendung.
Auch bei Streichglasuren gibt es Qualitätsunterschiede. Für den Schulbereich haben sich vor allem die Flüssigglasuren von Mayco (Foundations) bewährt. Sie werden 2-3mal dünn mit einem breiteren Borstenpinsel auf- getragen (zwischen den Schichten immer trocknen lassen). Dadurch erhält man eine gut deckende Oberfläche. Mit den Foundations können auch gut verschiedenfarbige Flächen aneinander gesetzt werden, die Glasuren verrinnen nicht und rinnen auch nicht ab. Preis: etwa 15.- für etwa 1/2l. (Stand 2019) Viele der Foundations können auch im Steinzeugbereich eingesetzt werden (siehe Etikett an der Flasche), manche ändern hier leicht die Farbe. Auch auf Porzellan kann damit glasiert werden.
Die Firmen Botz und auch Welte bieten ebenfalls Streichglasuren an, die ich persönlich nicht so gut finden. Gute Qualität bieten auch die Streichglasuren der Eigenmarke von www.skokan.at, oder Streichglasuren von Duncan.
Pulverglasuren können mit einer Flüssigkeit, die ebenfalls die Firma Widhalm anbietet (etwa 4.-/l), zu Streichglasuren angerührt werden (ohne Wasser). Praktisch ist hierfür ein elektrischer Mixstab. Es ergibt sich ebenfalls eine gute Streichbarkeit und Haftung, sodass die glasierten Objekte vor dem Brand auch gut angegriffen und transportiert werden können.
Rührt man Pulverglasuren nur mit Wasser an, setzen sie sich nach kurzer Zeit in der Flüssigkeit wieder ab und müssen zum Gebrauch erneut aufgerührt werden. Auch bleibt beim Transport das Pulver statt an der Keramik oft an den Fingern kleben.
Im Handel sind ebenfalls Effektglasuren und Kristallglasuren, hier braucht es ein wenig Übung im Umgang, damit nichts abrinnt und die Kristalleffekte gesteuert werden können. Pulverglasuren können samt dem zugehörigen Streichmittel auch bei Fa. Widhalm bezogen werden.
Glasurfehler
Abrollen: Ist der Scherben vor dem Glasieren nicht wirklich staubfrei, kann die Glasur nicht haften und rollt ab. Mit sauberem Pinsel vor dem Glasieren staubfrei machen Rauhigkeit: zu dünn glasiert
Abblättern: zu dick glasiertNadelstiche: Glasur und Ton passen nicht zusammen. Oder zu dick glasiert, oder Ton gast aus.
Abfließen: Temperatur zu hoch, zu dick glasiert, vor allem im unteren Gefäßbereich
Abblättern vor dem Brand: zu dick glasiert, oder nach dem Glasieren innen noch zu feucht, um außen zu Glasieren
Glasurrisse nach dem Brand: Glasur und Ton passen nicht zusammen, oder zu schnelles Abkühlen des Ofens (Tür zu früh geöffnet)
GK 2.3 Fertigungstechnik Keramik WS 2019
glasieren
Brennkurven
so oder ähnlich sollten die Brennkurven aussehen. Temperatur der Glasurbrände richtet sich IMMER nach der verwendeten Glasur
GK 2.3 Fertigungstechnik Keramik WS 2019
Ofen
Brennofen
Grundsätzlich sind 2 Brände zu unterscheiden:
• Der Rohbrand oder Schrühbrand
• Der Glasur- oder Glattbrand
Rohbrand
Der Rohbrand erfolgt nach einer vollständigen Durchtrocknung der getöpferten Stücke (je nach Zim- mertemperatur einige Tage).
Die Endtemperatur liegt hier bei etwa 960°. Im Ofen können die Teile auch gestapelt werden.
Ist man unsicher, ob die Stücke schon völlig durchgetrocknet sind oder hat man sehr dicke Stücke dabei, ist ein Temperaturanstieg von 70°/h bis zu 600° sinnvoll, danach kann mit 100-150°/h bis zur Endtemperatur von 960°geheizt werden. Haltezeit, also eine Zeit mit konstanter Endtemperatur, braucht es hierbei nicht.
Sind es dünne, gut getrocknete Stücke, kann von Anfang an mit etwa 120°/h gefahren werden. Auf der sicheren Seite ist man auch hier mit Anstieg 100°/h.
Nach dem Schrühbrand kann glasiert werden.
Glasurbrand
Die Endtemperatur des Glasurbrandes richtet sich nach der Schmelztemperatur der verwendeten Glasuren, in der Schule meist im Steingutbereich bei etwa 1020° - 1030°. Auf jeder Glasurverpackung ist die ideale Temperatur angegeben.
Die maximale Brenntemperatur für verschiedene Tone steht ebenfalls auf der Verpackung angegeben. Beim Glasurbrand müssen die Teile im Ofen auf Füßchen stehen, um Festkleben zu verhindern, ge- stapelt werden kann da nicht.
Brennt man bei höheren Temperaturen, etwa um 1200°-1300°, bewegt man sich im Steinzeugbereich. Achtung: die Glasuren müssen dann ebenfalls für eine höhere Brenntemperatur ausgerichtet sein. Nach einem Steinzeugbrand ist der Ton nahezu wasserdicht (gesintert). Danach kann nicht mehr glasiert werden.
Beim Glasurbrand kann schneller geheizt werden.
Bis zum Quarzsprung bei etwa 600° mit 150°/h, dann mit 200°-240° bis zur Endtemperatur mit einer Haltezeit von 10-20 Minuten.
Mischbrand
Selten hat man einen Ofen voll Rohware oder voll glasierter Ware. Man kann da auch mischen, die Einstellung richtet sich nach der empfindlicheren Rohware, die Endtemperatur nach der verwendeten Glasur.
Anstieg mit 70°-100°/h bis 600°, dann mit 100°-120° bis 1020°, Haltezeit etwa 20min.
Bei diesen Steuerungselementen lassen sich verschiedene Brennprogramme einspeichern, meist 10. Alle sind etwa ähnlich zu programmieren.
Lege eine Liste mit den Anstiegen und Endtemperaturen an, siehe Brennkurven!
GK 2.3 Fertigungstechnik Keramik WS 2019
Ofen
Literatur zum Thema Keramik
GK 2.3 Fertigungstechnik Keramik WS 2019
books
Literatur zum Thema Keramik
Bildquelle, Textquelle: www.amazon.de, Zugriff am 18.2.18
GK 2.3 Fertigungstechnik Keramik WS 2019
books
Was ist Raku?
Bild: Keramik4u, Georg Niemann
Raku ist eine uralte japanische Brenntechnik. Ursprünglich wurden auf diese Art Teeschalen hergestellt.
Heute ist Raku über die ganze Welt verbreitet. Die vorgeschrühte Ware wird glasiert; der Glasur- brand findet im Holzofen bei etwa 1000 Grad statt und dauert etwa 30 Minuten. Wenn die Glasur geschmolzen ist, werden die Stücke mit der Zange rotglühend aus dem Ofen genommen und nach kurzer Abkühlphase in einer Tonne mit Heu oder Sägespänen abgeräuchert. Dabei ent- steht die charakteristische Schwarzfärbung der Glasurrisse und der unglasierten Stellen. Durch schwer zu beeinflussende Oxidationsvorgänge in der Glasur gleicht am Ende kaum ein Stück dem anderen.
wichtig ist, dass die Stücke nicht heißer als 960° ge- schrüht werden!
Film zum Thema: http://www.youtube.com/watch?v=I0HSMZxG8Ks
GK 2.3 Fertigungstechnik Keramik WS 2019
raku
Sägemehlbrand
Benötigt werden: ein Metall-Topf mit Löchern an der Seite oder wie im Bild ein Metall-Mistkübel, Sägemehl (Kleintier- streu), Zeitungspapier, kleinere und größere Holzreste, An- zünder, evtl Alufolie zum Abdecken, Deckel für den Mistkübel oder den Topf. Ein Platz im Garten mit Abstand zu den Nach- barn ist gut! Und natürlich die bei 960° geschrühten Stücke.
Alles wird gut mit Sägemehl abgedeckt. Obenauf wird jetzt Feuer gemacht, mit Papier und kleinen Holzstückchen. Darauf kommen dann etwas größere Holzstücke.
Am besten nimmt polierte Keramik die Farbe an! Dazu werden lederharte Stücke mit einem Stein-Nugget poliert. Die Stücke werden dann im Rohbrand bei 960° geschrüht. Danach kann ein Sägemehlbrand gemacht werden.
Wenn keine Flammen mehr zu sehen sind, kann man einen Deckel oder ein Blech auflegen, aber Luft muss noch dazu kommen. Nach einiger Zeit sind die Sägespäne bis zum Boden durchgeglost und die Stücke können entnommen werden. Mit Fett (ich verwende am liebsten Büffelbeize) und Bürste kann der Glanz aktiviert werden.
In das Brenngefäß kommt zuerst eine Lage Sägemehl. Dann werden die geschrühten Stücke eingesetzt. Mit Alufolie kön- nen Teile abgedeckt und dadurch Effekte erzielt werden. Man kann ruhig mehrere Schichten Keramik einlegen, aber immer mit Sägemehl dazwischen.
GK 2.3 Fertigungstechnik Keramik WS 2019
extra
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Keramikskript 2019
- 1 - 33
Pages: